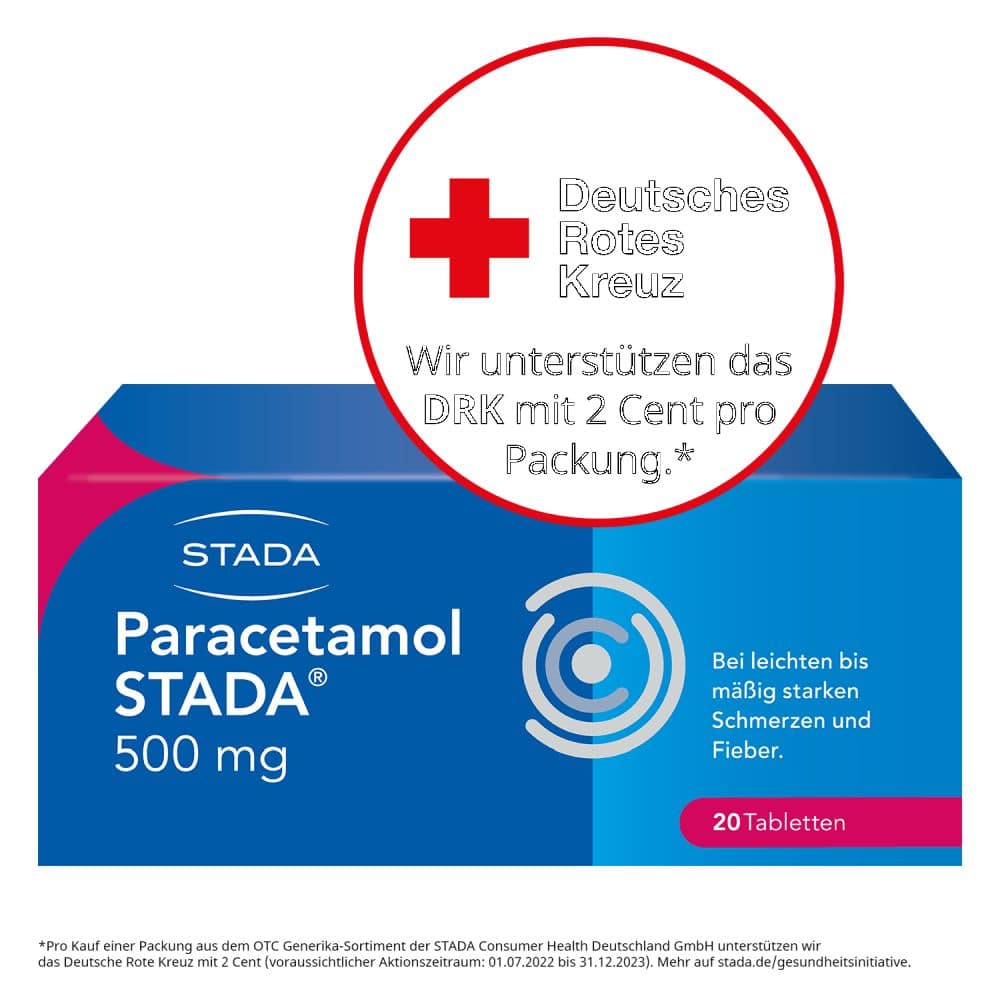Phlegmone (2 Produkte)
Die Ursachen der Erkrankung
Der Auslöser für eine Phlegmone ist in der Regel ein Befall mit Bakterien. In den meisten Fällen handelt es sich um das Bakterium Staphylococcus aureus. Die phlegmonösen Entzündungsherde können aber auch durch andere Bakterien aus der Gruppe der A-Streptokokken hervorgerufen werden. So haben Untersuchungen ergeben, dass sich auch Streptococcus pyogenes häufiger in einer Phlegmone nachweisen lassen.
Während die Bakterien einer gesunden Hautbarriere und einem starken Immunsystem normalerweise nichts anhaben können, ist dies bei immungeschwächten Personen anders. Die Bakterien können in das Gewebe eindringen, wenn sich auf der Haut offene Wunden zeigen.
Von hier aus breiten sie sich aus. Sie ziehen sich über mehrere Hautschichten in den Körper hinein. Dies sorgt für eine Entzündung und die Ausbildung einer Phlegmone. Die Gefahr der Phlegmone bei einer großen Wunde ist höher als bei einer kleinen Wunde. Dennoch reichen oft auch kleine Wunden reichen aus. Hautschäden selbst werden auf unterschiedliche Weise hervorgerufen.
Möglich ist eine Verletzung durch einen Sturz, einen Biss oder auch einen Schnitt mit dem Messer. Aber auch noch kleinere Wunden können eine Eintrittspforte darstellen. Hierbei wird von Bagatellverletzungen gesprochen.
Eine weitere Ursache für eine Infektion mit den auslösenden Bakterien ist eine Verschleppung durch medizinische Eingriffe.
Entstehung der einzelnen Varianten
Die Grundlage für die Entstehung einer Phlegmone ist eine Verletzung, über die Bakterien in den Körper eindringen und sich hier ausbreiten können. Abhängig von der Lage der Phlegmone können die Ursachen jedoch noch etwas näher beschrieben werden.
- Die Ursache für eine Lidphlegmone
Vor der Entstehung einer Lidphlegmone gab es bereits eine Entzündung am Lid. Hierbei kann es sich um ein einfaches Gerstenkorn handeln. Aber auch ein Furunkel oder ein Ekzem ist eine beliebte Eintrittspforte für die Erreger. - Die Ursache für eine V-Phlegmone
Die V-Phlegmone entsteht zwischen dem kleinen Finger sowie dem Daumen und steht in einer direkten Verbindung mit den Sehnenscheiden dieser beiden Finger. Die Verbindung der Sehnenscheiden befindet sich am Handgelenk. Dies ist auch einer der Gründe, warum die Phlegmone genau hier entsteht. Über die Sehnen kann sie sich ausbreiten. Auch an anderen Fingern kann eine Phlegmone entstehen. Hier ist es aber wichtig zu wissen, dass es sich dann um eine lokale Entzündung handelt, die bei dem jeweiligen Finger verbleibt und nicht auf die weiteren Sehnenscheiden übergeht. - Die Ursache für eine Sehnenscheidenphlegmone
Es gibt auch die allgemeine Sehnenscheidenphlegmone, die auftreten kann. Über eine Stichwunde oder auch eine Schnittverletzung treten die Bakterien ein. Das Gewebe selbst schwillt an. Durch die Lage direkt an der Sehnenscheide wird die Versorgung der Blutgefäße eingeschränkt. Die Nährstoffversorgung der Sehnenscheide lässt nach. Nach und nach stirbt das Gewebe ab. Dadurch können sich die Bakterien noch weiter ausbreiten. - Die Ursachen für eine Orbitaphlegmone
Bei dieser Form der Phlegmone entwickelt sich die Infektion im Bereich der Augenhöhle. Sie dehnt sich über das Weichteilgewebe aus. Einer der häufigsten Auslöser ist eine Nasennebenhöhlenentzündung. Die Nasennebenhöhlen befinden sich in einer direkten Nähe zur Augenhöhle. Die Bakterien aus der Entzündung wandern aus der Nase weiter in die Augenhöhle. Dafür greifen sie auf die Knochenlamellen zurück, die zwar sehr dünn sind, dafür aber eine Verbindung darstellen. In wenigen Fällen treten die Bakterien, die als Auslöser einer Phlegmone an der Augenhöhle gelten, über eine Wunde am Kopf ein oder wandern über das Blut zum betroffenen Bereich.
Die Übersicht zeigt, dass die Ursachen für eine Phlegmone immer in einer Wunde oder auch einer Entzündung im Körper zu suchen sind, die beste Voraussetzungen für den Eintritt und die Ausbreitung der Bakterien bieten. Umso wichtiger ist eine umfassende Hygiene und eine schnelle Behandlung offener Wundbereiche.
Diagnose der Phlegmone
Die Diagnose einer Phlegmone erfolgt in vielen Fällen vor allem über eine Sichtung des betroffenen Bereiches. Im ersten Schritt wird der Arzt jedoch einige Fragen stellen, die Aufschluss darüber geben können, ob der Patient Voraussetzungen für die Entstehung der Infektion zeigt. Relevant sind die folgenden Fragen:
- Wann sind die Beschwerden zum ersten Mal aufgetreten?
- Gab es in den letzten Wochen eine Erkrankung?
- Liegt ein schwaches Immunsystem vor, beispielsweise durch eine Erkrankung?
- Hat der Patient Fieber?
- Gibt es Wunden am Körper?
Bereits anhand der Antworten lässt sich erkennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Phlegmone ist. Anschließend folgt die körperliche Untersuchung, die eine Ergänzung zur Anamnese darstellt.
Der Arzt wird sich die vermutliche Phlegmone ansehen und genau prüfen, inwieweit sich in der Umgebung Verletzungen oder auch Wunden befinden. Um eine wirklich umfassende Diagnose zu erhalten, werden auch bildgebende Verfahren eingesetzt.
Zur Kontrolle der Tiefe der Entzündung wird mit einem Ultraschall gearbeitet. Ergibt dieser keine klaren Ergebnisse, sollte zusätzlich ein MRT durchgeführt werden. Die Magnetresonanztomographie ermöglicht eine detaillierte Darstellung des Weichgewebes.
Befindet sich die Phlegmone im Bereich des Schädels, ist eine Computertomografie, ein CT, die erste Wahl. Diese sorgt für eine optimale Darstellung der Nasennebenhöhlen und der Augenhöhle.
Möglicherweise sieht der Arzt die Notwendigkeit, einen Abstrich aus der Wunde zu entnehmen und diesen auf den genauen Erreger zu untersuchen. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Therapie passgenau auf die Erreger abzustimmen.
Bei einer schweren Phlegmone wird zudem das Blut des Patienten kontrolliert. Die Entzündungswerte geben Aufschluss darüber, ob die Therapie anschlägt. Unter anderem wird der Arzt die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, sowie den CRP-Wert prüfen. Der CRP-Wert stellt das C-reaktive Protein dar.
Es kann notwendig werden, andere Fachärzte für die Behandlung hinzuzuziehen.
Behandlungsmethoden bei Phlegmone
Nach der Diagnose einer Phlegmone wird die Behandlung zusammengestellt. Die Therapie basiert auf der Schwere der Phlegmone. Die Erkrankung wird durch Bakterien ausgelöst. Daher ist eine Behandlung mit Antibiotika die erste Wahl. Sie sorgen dafür, dass sich die Bakterien nicht vermehren und töten den vorhandenen Befall ab. Verwendet werden beispielsweise:
- Penicillin, wie Flucloxacillin
- Cephalosporin, wie Cefuroxim oder Cefazolin
- Clindamycin
Wird bei der Diagnose ein Abstrich genommen oder eine Blutkultur angelegt, lässt sich genau bestimmen, welche Bakterien der Auslöser für die Phlegmone sind. In dem Fall kann die antibiotische Therapie direkt auf die Bakterien eingestellt werden. Teilweise wird ein Abstrich auch dann gemacht, wenn die erste Therapie nicht anschlägt.
Liegt ein schwerer Fall einer Phlegmone vor, ist eine Behandlung in Form eines chirurgischen Eingriffs notwendig. Es wird von einem Débridement gesprochen. Bei dem Eingriff wird das nekrotische Gewebe im Bereich der Phlegmone entfernt. Anschließend erfolgt die Spülung des Wundbereiches. Es kann notwendig werden, mit einer offenen Wundbehandlung zu arbeiten. In dem Fall wird die Wunde wie oben benannt behandelt. Anschließend wird sie jedoch nicht verschlossen, sondern bleibt geöffnet. Dadurch kann die Wunde mehrfach gespült werden und es ist leichter möglich, für eine sterile und antiseptische Wundversorgung zu arbeiten.
Teilweise kommen Drainagen zum Einsatz. Aus einer drainierten Wunde lässt sich die Wundflüssigkeit leichter ableiten. Sind die Nasennebenhöhlen von der Phlegmone betroffen, ist es in einigen Fällen notwendig, hier mit einem chirurgischen Eingriff zu arbeiten.
Was Betroffene tun können
Wer unter einer Phlegmone leidet, sollte direkt den Arzt aufsuchen. Je schneller die Behandlung erfolgt, umso geringer ist das Risiko für Komplikationen. Eine Medikation muss nach Vorgabe bis zum Ende durchgeführt werden. Zudem ist es empfehlenswert, den betroffenen Bereich möglichst zu kühlen und höher zu lagern. Eine Ruhigstellung wird ebenfalls empfohlen. So wird verhindert, dass sich die Bakterien weiter im Körper ausbreiten.
Haben Betroffene Schmerzen, können zusätzlich Medikamente mit entzündungshemmenden Eigenschaften eingenommen werden. Bewährt hat sich beispielsweise Ibuprofen. Durch die entzündungshemmenden Wirkstoffe wird der Heilungsprozess unterstützt. Gleichzeitig lassen die Schmerzen nach und der Patient kann sich leichter entspannen. Dies fördert ebenfalls die Regeneration des Körpers.
Phlegmone vorbeugen
Für die Vorbeugung einer Phlegmone ist Hygiene bei einer offenen Wunde oder Hauterkrankungen besonders wichtig. Vorliegende Hauterkrankungen sollten immer behandelt werden. Ein Beispiel hierfür sind Pilzerkrankungen der Haut, wie Fußpilz, der durch die Verletzungen der Haut für eine Eintrittspforte für die Bakterien sorgt.
Eine Pflege der Haut sowie eine schnelle Versorgung von vorliegenden Wunden sind ebenfalls hilfreich als vorbeugende Maßnahme.
Leiden Patienten unter einem Geschwür oder unter chronischen Wunden, ist eine fachgerechte Wundpflege unbedingt zu empfehlen.
Mögliche Folgen der Phlegmone
Eine Phlegmone kann die Entstehung einer Thrombose unterstützen. Abhängig davon, wo sich die Blutgerinnsel bilden, kann es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. Liegt beispielsweise eine Phlegmone im Gesichtsbereich vor, ist die Gefahr einer Sinusvenenthrombose hoch. Weitere mögliche Folgen bei einer Phlegmone im Gesichtsbereich sind Entzündungen der Sehnerven sowie eine Entzündung der Hirnhaut (Meningitis, Hirnhautentzündung).
Wird eine Phlegmone zu spät entdeckt oder erfolgt der Behandlungsbeginn nicht rechtzeitig, dringen die Bakterien weiter in den Körper ein: Sie verteilen sich über die Lymphgefäße und die Blutgefäße auf den Körper. Dies führt zur Ausbildung einer Sepsis. Eine Sepsis ist eine bakterielle Blutvergiftung, die zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen kann.
Risikogruppen für eine Phlegmone
Einige Menschen gehören zur Risikogruppe, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, eine Phlegmone auszubilden. Vor allem in Bezug auf die Ausbildung einer schweren Phlegmone spielen die folgenden Faktoren eine wichtige Rolle:
- fortgeschrittenes Alter bei der betroffenen Person
- Immunabwehr ist beeinträchtigt, beispielsweise durch die Einnahme von immunsupprimierenden Medikamenten oder einer Chemotherapie
- Erkrankungen, die Durchblutungsstörungen auslösen, wie die periphere arterielle Verschlusskrankheit oder Diabetes
- Befall mit aggressiven Bakterienstämmen
Unterschiede zwischen Phlegmone und anderen Weichteilentzündungen
Es gibt verschiedene Infektionen des Weichgewebes. Dadurch ist es nicht immer einfach zu erkennen, ob es sich um eine Phlegmone handelt oder möglicherweise ein Abszess oder eine Fasziitis der Auslöser für das entzündete und geschwollen Gewebe ist. Neben der Wundrose sind dies zwei weitere Erkrankungen, die als eine bakterielle Entzündung auf der Haut und im Weichgewebe entstehen können.
Damit die passende Behandlung und Therapie durch den Arzt ausgewählt werden kann, ist eine genaue Diagnose allerdings besonders wichtig. Eine Verwechslungsgefahr besteht bei den folgenden Erkrankungen:
<ol<
- Abszess
Der Abszess entsteht in den tiefen Hautschichten. Es handelt sich um einen Hohlraum, der sich mit Eiter füllt. Eine Besonderheit ist, dass sich der Abszess klar abgrenzt und abkapselt. Es ist möglich, dass sich im Rahmen einer Phlegmone auch ein Abszess entwickelt. Teilweise schmerzt ein Abszess bei Druck oder Berührung. - Wundrose (Erysipel)
Die Wundrose findet sich ebenfalls an Wunden oder Verletzungen. Die Haut nimmt eine hellrote Färbung an, spannt und glänzt. Eine Wundrose ist allerdings sehr scharf begrenzt, auch wenn sie sich nach und nach ausbreitet. Abhängig von der Ausprägung geht sie einher mit Fieber. Sie verbleibt auf den äußeren Hautschichten. - Nekrotisierende Fasziitis
Die nekrotisierende Fasziitis tritt meist an den Armen oder den Beinen auf und ist eine bakterielle Infektion, die schnell lebensbedrohlich werden kann. Sowohl die Faszien als auch die Unterhaut und die Haut entzünden sich. Meist greift die Fasziitis zudem auf die Muskulatur über. Auch bei dieser Erkrankung ist der Auslöser eine Infektion mit Streptokokken. Die Bakterien geben Toxine an die Umgebung ab. Die Toxine lösen die Entstehung von Blutgerinnseln aus. Die Gerinnsel selbst sind sehr klein. Allerdings verhindern sie die Zufuhr von Sauerstoff zu den Zellen. Diese sterben an, sie nekrotisieren (Entstehung von Nekrosen). Diese Erkrankung geht mit sehr starken Schmerzen und oft auch hohem Fieber einher.
Wie sieht es mit der Kostenübernahme bei einer Phlegmone aus?
Bei der Phlegmone handelt es sich um eine Erkrankung, deren Diagnostik und Therapie vollständig von der Krankenkasse übernommen wird. Dies gilt für die medizinisch anerkannten Behandlungen, die der Arzt verschreibt und durchführt. In einigen Fällen kann es zu einem Selbstbehalt kommen. Dies ist abhängig von der Krankenversicherung, die der Patient hat.
Überblick zu den bakteriellen Hautinfektionen
Die Haut ist ein natürlicher Schutz des Körpers und verfügt über eine sehr gute Barriere, sodass Bakterien es schwer haben, wenn sie in den Körper eintreten möchten. Eine gestörte Barriere jedoch kann dafür sorgen, dass bakterielle Hautinfektionen sich ausbreiten. Eine bakterielle Hautinfektion tritt dann auf, wenn Bakterien es schaffen, in die Haut einzudringen. Dafür stehen verschiedene Eintrittspforten zur Verfügung. Einige Bakterien schaffen es, direkt über die kleinsten Risse der Haut oder die Haarfollikel einzudringen. Gerade größere Verletzungen sind jedoch eine häufige Pforte. Dazu gehören:
- Tierbisse
- Sonnenbrand oder andere Verbrennungen
- Operationsnarben
- Einstiche
- Kratzer
- Hauterkrankungen, die für eine Störung der Barriere sorgen
Die Ursache für einen starken Bakterienbefall kann unterschiedlich sein. Oft reicht es schon aus, bei der Gartenarbeit die Wunde mit Erde zu verschmutzen oder möglicherweise in verunreinigtem Wasser zu baden, wie im See oder im Meer.
Bei den bakteriellen Hautinfektionen wird unterschieden zwischen den weniger schwerwiegenden und den schwerwiegenden Ausführungen. Eine eher kleine Infektion tritt bei den folgenden Erkrankungen auf:
- Furunkel
- Karbunkel
- Impetigo
- Ekthym
- Erythrasma
- kleine Abszesse der Haut
Zu den schweren bakteriellen Infektionen der Haut, die auch in das Weichgewebe eintreten, gehören:
- Phlegmone
- Große Abszesse der Haut
- Erysipel
- Wundinfektionen
- Nekrotisierende Hautinfektionen
- Lymphangitis
Infektionen der Haut können durch unterschiedliche Bakterien hervorgerufen werden. Einer der ersten Schritte bei einer Diagnostik ist es daher immer, das Bakterium zu identifizieren, um hier effektiv mit einer Therapie arbeiten zu können.
Die Bakterien, die besonders häufig der Auslöser sind, sind Streptokokken sowie Staphylokokken. Eine hohe Gefahr bringt der bekannte MSRA-Keim mit. Hierbei handelt es sich um den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus. Er wird auch gerne als Krankenhauskeim bezeichnet. Der MSRA hat eine Resistenz gegenüber den meisten Antibiotika entwickelt. Es ist daher besonders wichtig, dass eine Infektion mit MSRA schnell entdeckt wird, um die Behandlung darauf abstimmen zu können.
Risikofaktoren sind vielseitig
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Barriere der Haut gestört ist. Eine mögliche Ursache dafür ist beispielsweise eine Erkrankung mit Diabetes. Nicht nur die Phlegmone hat ein leichtes Spiel, denn Diabetes sorgt dafür, dass die Infektionsabwehr der Haut deutlich vermindert ist. Gleichzeitig ist die Gefahr größer, dass Wunden auf der Haut entstehen. Ältere Menschen haben ein höheres Risiko, an einer bakteriellen Hauterkrankung zu erkranken. Ein zusätzliches Risiko entsteht dann, wenn die Personen im Pflegeheim wohnen oder ins Krankenhaus müssen.
Menschen, die Hepatitis haben oder an einer Immunschwäche leiden, gehören ebenfalls zu den Risikogruppen für die verschiedenen bakteriellen Hautinfektionen.
Generell ist eine beschädigte Haut bei allen Menschen eine Gefahr für das Eindringen von Bakterien. Neben einer guten Wundbehandlung ist es in dem Zusammenhang wichtig, auf eine erhöhte Hygiene zu achten. Kommt es zu frischen Wunden auf der Haut, wie bei Schnitten oder Schürfwunden, sollten diese direkt gereinigt werden. Ebenfalls wichtig ist es, die Wunde mit einem sterilen Verband abzudecken. Dadurch lässt sich die Gefahr mindern, dass Bakterien in den Körper eintreten und eine Infektion auslösen.
FAQ: Phlegmone
Ist Phlegmone ansteckend?
Die Ursache für eine Phlegmone ist normalerweise eine Infektion durch Bakterien. Besonders häufig nachgewiesen werden Streptokokken oder auch Staphylokokken. Die Erkrankung entsteht, wenn die Bakterien in die Haut eindringen und hier für eine Entzündung sorgen. Die Übertragung der auslösenden Bakterien ist möglich. Dringen diese in das Gewebe ein, können sie auch bei einer anderen Person für eine Phlegmone sorgen. Es wird aber nicht von einer Ansteckung gesprochen.
Muss ich mit einer Phlegmone zum Arzt?
Zeigt sich eine Phlegmone auf der Haut, ist eine Kontrolle durch den Arzt immer zu empfehlen. Hierbei kann die erste Untersuchung beim Hausarzt erfolgen. Dieser kann einschätzen, ob eine Behandlung durch einen Facharzt notwendig ist oder der Patient ins Krankenhaus muss.
Ist eine Phlegmone gefährlich?
Eine Phlegmone dringt oft tief in das Gewebe vor und daher stellt sich die Frage, ob es sich um eine gefährliche Erkrankung handelt, die möglicherweise schwere Komplikationen nach sich ziehen kann. Gefährlich wird eine Phlegmone beispielsweise dann, wenn sich ein Abszess bildet, der sich mit Eiter füllt. Unbehandelt kann ein Abszess eine Infektion im Körper auslösen und bis hin zu einer Blutvergiftung führen. Daher sollte Phlegmone immer behandelt werden.
Wie erfolgt die Diagnose?
Um Phlegmone zu diagnostizieren, reicht es normalerweise aus, sich das Erscheinungsbild der Haut anzusehen. Sollte Unsicherheit darüber bestehen, welche Bakterien der Auslöser sind, kann ein Abstrich sinnvoll sein.
Die Phlegmone stellt eine Erkrankung des weichen Bindegewebes sowie der umliegenden Haut dar. Durch das Eindringen in tiefere Gewebsschichten breitet sich die Phlegmone auch unter der Haut aus und kann bis an die Muskulatur heranreichen. Eine Phlegmone tritt häufig bei Menschen auf, deren Abwehrsystem bereits geschwächt ist oder die unter Wunden auf der Haut leiden. Dadurch können die Bakterien die Hautbarriere durchdringen und für eine Entstehung der Phlegmone sorgen.
Das Wichtigste in Kürze
- Es handelt sich um eine bakterielle Entzündung, die überall auf der Haut entstehen kann.
- Als Erreger zeigen sich meist Streptokokken oder auch Staphylococcen.
- Die Symptome sind unterschiedlich, zeigen sich jedoch vor allem durch Rötungen und Schwellungen auf der Haut.
Phlegmone: Definition
Die Phlegmone wird ausgelöst durch eine bakterielle Infektion der Haut, die sich bis auf das Untergewebe und die Muskeln ausbreiten kann. In einigen Fällen kann es passieren, dass die Ausbreitung zu schweren Komplikationen führt.
Teilweise wird die Phlegmone mit einer Wundrose verwechselt oder gleichgesetzt. Hier gibt es jedoch einen erheblichen Unterschied. Während sich die Wundrose (Erysipel) normalerweise auf die oberen Hautschichten begrenzt, dringt die Phlegmone in die tieferen Hautschichten vor.
Sowohl die Wundrose als auch die Phlegmone laufen in der Medizin unter der Bezeichnung „Zellulitis“. Hierbei handelt es sich um den Fachbegriff, der für die Bezeichnung von Infektionen steht, die vor allem die Haut sowie das unter der Haut liegende Gewebe betreffen.
Im Englischen wird von einer Cellulitis gesprochen. Dabei ist die Phlegmone nicht zu verwechseln mit der Cellulite, die auch unter dem Begriff der Orangenhaut bekannt ist.
Symptome einer Phlegmone
Auch wenn die Phlegmone vor allem die unteren Hautschichten betrifft und bis zu den Muskeln sowie in das tief liegende Bindegewebe vordringen kann, zeigen sich dennoch Symptome auf der Haut. Grund dafür ist, dass sich die Phlegmone normalerweise direkt an einer Stelle bildet, wo die Bakterien eingedrungen sind. Die Symptome zeigen sich rund um die Wundstelle und weisen die folgenden Anzeichen auf:
- Rötung, die sich dunkel oder bläulich von der Haut abhebt
- die Rötung ist nicht oder nur sehr unscharf begrenzt
- die Haut fühlt sich an der betroffenen Stelle warm an
- es bilden sich Ödeme, also Flüssigkeitsansammlungen unter der Haut
- bei Berührung zeigt sich ein Druckschmerz
- es kann sich ein Spontanschmerz ausbilden
- bei einer fortgeschrittenen Phlegmone kommt es zu Eiteransammlungen
- mögliche tote Zellen sorgen für Verfärbungen unter der Haut
Weitere Symptome, die sich nicht an der betroffenen Stelle zeigen, aber dennoch im Zusammenhang mit einer Phlegmone stehen können, sind Fieber und Abgeschlagenheit, ein allgemeines starkes Krankheitsgefühl sowie eine Tachykardie. Die hohe Herzfrequenz kann zu Angstzuständen führen. Breiten sich die Infektion weiter auf den Körper aus, ist es auch möglich, dass Betroffene einen Kreislaufzusammenbruch erleiden oder unter Atemnot leiden.
Beschreibung einer Phlegmone
Da Phlegmone an verschiedenen Körperbereichen auftreten können, ist es hilfreich, eine genaue Beschreibung zu kennen. So lässt sich die Ausbreitung bereits zu beginnen erkennen und eine schnelle Behandlung umsetzen. Möglich ist es, dass sich die Phlegmone sowohl an den Händen und Sehnenscheiden als auch an der Zunge und im Mund, wie die Mundbodenphlegmone, sowie am Hals und dem Auge oder dem Lid zeigt.
Besonders weit verbreitet ist eine Entstehung der Phlegmone an den Füßen oder am Unterschenkel. Es kann sich eine begrenzte oder eine schwere Phlegmone bilden. Die begrenzte Phlegmone zieht sich nur bis zur Subkutis, also bis zur untersten Hautschicht.
Liegt eine schwere Phlegmone vor, kommt es zur Ausbreitung auf die Muskeln und das Bindegewebe. Es entstehen eitrige Herde, die sich weiter ausbreiten.
Arten der Phlegmone in der Übersicht
Abhängig davon, in welchem Bereich sich die Phlegmone zeigt, wird in der Medizin zwischen unterschiedlichen Arten unterschieden. Diese können auch zu verschiedenen Symptomen führen.
| Art | Beschreibung |
| V-Phlegmone | - bildet sich am kleinen Finger und dem Daumen - Entzündung stellt sich V-förmig dar - Verbindung erfolgt über Handwurzel am Handgelenk zwischen den Fingern - V-Phlegmone kann sich auf die gesamte Hand ausbreiten - dann wird von einer Handphlegmone gesprochen |
| Lidphlegmone | - Entzündung besteht auf dem Augenlid - das Lid rötet sich - es schwillt an - einige Betroffene haben Schwierigkeiten, das Auge zu öffnen |
| Zungenphlegmone | - Entstehung im Mundbereich - auch als Glossitis phlegmonosa bekannt - Symptome sind Schmerzen beim Schlucken und Sprechen - der Zungenbereich kann anschwellen - eine Ausbreitung der Schwellung bis auf die Atemwege ist möglich - ein weiteres Symptom ist die Luftnot |
| Orbitalphlegmone | - Ausbreitung der Phlegmone im Gesicht - Entstehung eines Exophthalamus (hervorstehendes Auge) - Sehstörungen - Ausprägung einer Chemosis (Bindehautödem) - Anschwellen des Lids - Schwierigkeiten bei Augenbewegungen |
sofort lieferbar
sofort lieferbar
Die Ursachen der Erkrankung
Der Auslöser für eine Phlegmone ist in der Regel ein Befall mit Bakterien. In den meisten Fällen handelt es sich um das Bakterium Staphylococcus aureus. Die phlegmonösen Entzündungsherde können aber auch durch andere Bakterien aus der Gruppe der A-Streptokokken hervorgerufen werden. So haben Untersuchungen ergeben, dass sich auch Streptococcus pyogenes häufiger in einer Phlegmone nachweisen lassen.
Während die Bakterien einer gesunden Hautbarriere und einem starken Immunsystem normalerweise nichts anhaben können, ist dies bei immungeschwächten Personen anders. Die Bakterien können in das Gewebe eindringen, wenn sich auf der Haut offene Wunden zeigen.
Von hier aus breiten sie sich aus. Sie ziehen sich über mehrere Hautschichten in den Körper hinein. Dies sorgt für eine Entzündung und die Ausbildung einer Phlegmone. Die Gefahr der Phlegmone bei einer großen Wunde ist höher als bei einer kleinen Wunde. Dennoch reichen oft auch kleine Wunden reichen aus. Hautschäden selbst werden auf unterschiedliche Weise hervorgerufen.
Möglich ist eine Verletzung durch einen Sturz, einen Biss oder auch einen Schnitt mit dem Messer. Aber auch noch kleinere Wunden können eine Eintrittspforte darstellen. Hierbei wird von Bagatellverletzungen gesprochen.
Eine weitere Ursache für eine Infektion mit den auslösenden Bakterien ist eine Verschleppung durch medizinische Eingriffe.
Entstehung der einzelnen Varianten
Die Grundlage für die Entstehung einer Phlegmone ist eine Verletzung, über die Bakterien in den Körper eindringen und sich hier ausbreiten können. Abhängig von der Lage der Phlegmone können die Ursachen jedoch noch etwas näher beschrieben werden.
- Die Ursache für eine Lidphlegmone
Vor der Entstehung einer Lidphlegmone gab es bereits eine Entzündung am Lid. Hierbei kann es sich um ein einfaches Gerstenkorn handeln. Aber auch ein Furunkel oder ein Ekzem ist eine beliebte Eintrittspforte für die Erreger. - Die Ursache für eine V-Phlegmone
Die V-Phlegmone entsteht zwischen dem kleinen Finger sowie dem Daumen und steht in einer direkten Verbindung mit den Sehnenscheiden dieser beiden Finger. Die Verbindung der Sehnenscheiden befindet sich am Handgelenk. Dies ist auch einer der Gründe, warum die Phlegmone genau hier entsteht. Über die Sehnen kann sie sich ausbreiten. Auch an anderen Fingern kann eine Phlegmone entstehen. Hier ist es aber wichtig zu wissen, dass es sich dann um eine lokale Entzündung handelt, die bei dem jeweiligen Finger verbleibt und nicht auf die weiteren Sehnenscheiden übergeht. - Die Ursache für eine Sehnenscheidenphlegmone
Es gibt auch die allgemeine Sehnenscheidenphlegmone, die auftreten kann. Über eine Stichwunde oder auch eine Schnittverletzung treten die Bakterien ein. Das Gewebe selbst schwillt an. Durch die Lage direkt an der Sehnenscheide wird die Versorgung der Blutgefäße eingeschränkt. Die Nährstoffversorgung der Sehnenscheide lässt nach. Nach und nach stirbt das Gewebe ab. Dadurch können sich die Bakterien noch weiter ausbreiten. - Die Ursachen für eine Orbitaphlegmone
Bei dieser Form der Phlegmone entwickelt sich die Infektion im Bereich der Augenhöhle. Sie dehnt sich über das Weichteilgewebe aus. Einer der häufigsten Auslöser ist eine Nasennebenhöhlenentzündung. Die Nasennebenhöhlen befinden sich in einer direkten Nähe zur Augenhöhle. Die Bakterien aus der Entzündung wandern aus der Nase weiter in die Augenhöhle. Dafür greifen sie auf die Knochenlamellen zurück, die zwar sehr dünn sind, dafür aber eine Verbindung darstellen. In wenigen Fällen treten die Bakterien, die als Auslöser einer Phlegmone an der Augenhöhle gelten, über eine Wunde am Kopf ein oder wandern über das Blut zum betroffenen Bereich.
Die Übersicht zeigt, dass die Ursachen für eine Phlegmone immer in einer Wunde oder auch einer Entzündung im Körper zu suchen sind, die beste Voraussetzungen für den Eintritt und die Ausbreitung der Bakterien bieten. Umso wichtiger ist eine umfassende Hygiene und eine schnelle Behandlung offener Wundbereiche.
Diagnose der Phlegmone
Die Diagnose einer Phlegmone erfolgt in vielen Fällen vor allem über eine Sichtung des betroffenen Bereiches. Im ersten Schritt wird der Arzt jedoch einige Fragen stellen, die Aufschluss darüber geben können, ob der Patient Voraussetzungen für die Entstehung der Infektion zeigt. Relevant sind die folgenden Fragen:
- Wann sind die Beschwerden zum ersten Mal aufgetreten?
- Gab es in den letzten Wochen eine Erkrankung?
- Liegt ein schwaches Immunsystem vor, beispielsweise durch eine Erkrankung?
- Hat der Patient Fieber?
- Gibt es Wunden am Körper?
Bereits anhand der Antworten lässt sich erkennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Phlegmone ist. Anschließend folgt die körperliche Untersuchung, die eine Ergänzung zur Anamnese darstellt.
Der Arzt wird sich die vermutliche Phlegmone ansehen und genau prüfen, inwieweit sich in der Umgebung Verletzungen oder auch Wunden befinden. Um eine wirklich umfassende Diagnose zu erhalten, werden auch bildgebende Verfahren eingesetzt.
Zur Kontrolle der Tiefe der Entzündung wird mit einem Ultraschall gearbeitet. Ergibt dieser keine klaren Ergebnisse, sollte zusätzlich ein MRT durchgeführt werden. Die Magnetresonanztomographie ermöglicht eine detaillierte Darstellung des Weichgewebes.
Befindet sich die Phlegmone im Bereich des Schädels, ist eine Computertomografie, ein CT, die erste Wahl. Diese sorgt für eine optimale Darstellung der Nasennebenhöhlen und der Augenhöhle.
Möglicherweise sieht der Arzt die Notwendigkeit, einen Abstrich aus der Wunde zu entnehmen und diesen auf den genauen Erreger zu untersuchen. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Therapie passgenau auf die Erreger abzustimmen.
Bei einer schweren Phlegmone wird zudem das Blut des Patienten kontrolliert. Die Entzündungswerte geben Aufschluss darüber, ob die Therapie anschlägt. Unter anderem wird der Arzt die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, sowie den CRP-Wert prüfen. Der CRP-Wert stellt das C-reaktive Protein dar.
Es kann notwendig werden, andere Fachärzte für die Behandlung hinzuzuziehen.
Behandlungsmethoden bei Phlegmone
Nach der Diagnose einer Phlegmone wird die Behandlung zusammengestellt. Die Therapie basiert auf der Schwere der Phlegmone. Die Erkrankung wird durch Bakterien ausgelöst. Daher ist eine Behandlung mit Antibiotika die erste Wahl. Sie sorgen dafür, dass sich die Bakterien nicht vermehren und töten den vorhandenen Befall ab. Verwendet werden beispielsweise:
- Penicillin, wie Flucloxacillin
- Cephalosporin, wie Cefuroxim oder Cefazolin
- Clindamycin
Wird bei der Diagnose ein Abstrich genommen oder eine Blutkultur angelegt, lässt sich genau bestimmen, welche Bakterien der Auslöser für die Phlegmone sind. In dem Fall kann die antibiotische Therapie direkt auf die Bakterien eingestellt werden. Teilweise wird ein Abstrich auch dann gemacht, wenn die erste Therapie nicht anschlägt.
Liegt ein schwerer Fall einer Phlegmone vor, ist eine Behandlung in Form eines chirurgischen Eingriffs notwendig. Es wird von einem Débridement gesprochen. Bei dem Eingriff wird das nekrotische Gewebe im Bereich der Phlegmone entfernt. Anschließend erfolgt die Spülung des Wundbereiches. Es kann notwendig werden, mit einer offenen Wundbehandlung zu arbeiten. In dem Fall wird die Wunde wie oben benannt behandelt. Anschließend wird sie jedoch nicht verschlossen, sondern bleibt geöffnet. Dadurch kann die Wunde mehrfach gespült werden und es ist leichter möglich, für eine sterile und antiseptische Wundversorgung zu arbeiten.
Teilweise kommen Drainagen zum Einsatz. Aus einer drainierten Wunde lässt sich die Wundflüssigkeit leichter ableiten. Sind die Nasennebenhöhlen von der Phlegmone betroffen, ist es in einigen Fällen notwendig, hier mit einem chirurgischen Eingriff zu arbeiten.
Was Betroffene tun können
Wer unter einer Phlegmone leidet, sollte direkt den Arzt aufsuchen. Je schneller die Behandlung erfolgt, umso geringer ist das Risiko für Komplikationen. Eine Medikation muss nach Vorgabe bis zum Ende durchgeführt werden. Zudem ist es empfehlenswert, den betroffenen Bereich möglichst zu kühlen und höher zu lagern. Eine Ruhigstellung wird ebenfalls empfohlen. So wird verhindert, dass sich die Bakterien weiter im Körper ausbreiten.
Haben Betroffene Schmerzen, können zusätzlich Medikamente mit entzündungshemmenden Eigenschaften eingenommen werden. Bewährt hat sich beispielsweise Ibuprofen. Durch die entzündungshemmenden Wirkstoffe wird der Heilungsprozess unterstützt. Gleichzeitig lassen die Schmerzen nach und der Patient kann sich leichter entspannen. Dies fördert ebenfalls die Regeneration des Körpers.
Phlegmone vorbeugen
Für die Vorbeugung einer Phlegmone ist Hygiene bei einer offenen Wunde oder Hauterkrankungen besonders wichtig. Vorliegende Hauterkrankungen sollten immer behandelt werden. Ein Beispiel hierfür sind Pilzerkrankungen der Haut, wie Fußpilz, der durch die Verletzungen der Haut für eine Eintrittspforte für die Bakterien sorgt.
Eine Pflege der Haut sowie eine schnelle Versorgung von vorliegenden Wunden sind ebenfalls hilfreich als vorbeugende Maßnahme.
Leiden Patienten unter einem Geschwür oder unter chronischen Wunden, ist eine fachgerechte Wundpflege unbedingt zu empfehlen.
Mögliche Folgen der Phlegmone
Eine Phlegmone kann die Entstehung einer Thrombose unterstützen. Abhängig davon, wo sich die Blutgerinnsel bilden, kann es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. Liegt beispielsweise eine Phlegmone im Gesichtsbereich vor, ist die Gefahr einer Sinusvenenthrombose hoch. Weitere mögliche Folgen bei einer Phlegmone im Gesichtsbereich sind Entzündungen der Sehnerven sowie eine Entzündung der Hirnhaut (Meningitis, Hirnhautentzündung).
Wird eine Phlegmone zu spät entdeckt oder erfolgt der Behandlungsbeginn nicht rechtzeitig, dringen die Bakterien weiter in den Körper ein: Sie verteilen sich über die Lymphgefäße und die Blutgefäße auf den Körper. Dies führt zur Ausbildung einer Sepsis. Eine Sepsis ist eine bakterielle Blutvergiftung, die zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen kann.
Risikogruppen für eine Phlegmone
Einige Menschen gehören zur Risikogruppe, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, eine Phlegmone auszubilden. Vor allem in Bezug auf die Ausbildung einer schweren Phlegmone spielen die folgenden Faktoren eine wichtige Rolle:
- fortgeschrittenes Alter bei der betroffenen Person
- Immunabwehr ist beeinträchtigt, beispielsweise durch die Einnahme von immunsupprimierenden Medikamenten oder einer Chemotherapie
- Erkrankungen, die Durchblutungsstörungen auslösen, wie die periphere arterielle Verschlusskrankheit oder Diabetes
- Befall mit aggressiven Bakterienstämmen
Unterschiede zwischen Phlegmone und anderen Weichteilentzündungen
Es gibt verschiedene Infektionen des Weichgewebes. Dadurch ist es nicht immer einfach zu erkennen, ob es sich um eine Phlegmone handelt oder möglicherweise ein Abszess oder eine Fasziitis der Auslöser für das entzündete und geschwollen Gewebe ist. Neben der Wundrose sind dies zwei weitere Erkrankungen, die als eine bakterielle Entzündung auf der Haut und im Weichgewebe entstehen können.
Damit die passende Behandlung und Therapie durch den Arzt ausgewählt werden kann, ist eine genaue Diagnose allerdings besonders wichtig. Eine Verwechslungsgefahr besteht bei den folgenden Erkrankungen:
- Abszess
Der Abszess entsteht in den tiefen Hautschichten. Es handelt sich um einen Hohlraum, der sich mit Eiter füllt. Eine Besonderheit ist, dass sich der Abszess klar abgrenzt und abkapselt. Es ist möglich, dass sich im Rahmen einer Phlegmone auch ein Abszess entwickelt. Teilweise schmerzt ein Abszess bei Druck oder Berührung.
- Wundrose (Erysipel)
Die Wundrose findet sich ebenfalls an Wunden oder Verletzungen. Die Haut nimmt eine hellrote Färbung an, spannt und glänzt. Eine Wundrose ist allerdings sehr scharf begrenzt, auch wenn sie sich nach und nach ausbreitet. Abhängig von der Ausprägung geht sie einher mit Fieber. Sie verbleibt auf den äußeren Hautschichten.
- Nekrotisierende Fasziitis
Die nekrotisierende Fasziitis tritt meist an den Armen oder den Beinen auf und ist eine bakterielle Infektion, die schnell lebensbedrohlich werden kann. Sowohl die Faszien als auch die Unterhaut und die Haut entzünden sich. Meist greift die Fasziitis zudem auf die Muskulatur über. Auch bei dieser Erkrankung ist der Auslöser eine Infektion mit Streptokokken. Die Bakterien geben Toxine an die Umgebung ab. Die Toxine lösen die Entstehung von Blutgerinnseln aus. Die Gerinnsel selbst sind sehr klein. Allerdings verhindern sie die Zufuhr von Sauerstoff zu den Zellen. Diese sterben an, sie nekrotisieren (Entstehung von Nekrosen). Diese Erkrankung geht mit sehr starken Schmerzen und oft auch hohem Fieber einher.
Wie sieht es mit der Kostenübernahme bei einer Phlegmone aus?
Bei der Phlegmone handelt es sich um eine Erkrankung, deren Diagnostik und Therapie vollständig von der Krankenkasse übernommen wird. Dies gilt für die medizinisch anerkannten Behandlungen, die der Arzt verschreibt und durchführt. In einigen Fällen kann es zu einem Selbstbehalt kommen. Dies ist abhängig von der Krankenversicherung, die der Patient hat.
Überblick zu den bakteriellen Hautinfektionen
Die Haut ist ein natürlicher Schutz des Körpers und verfügt über eine sehr gute Barriere, sodass Bakterien es schwer haben, wenn sie in den Körper eintreten möchten. Eine gestörte Barriere jedoch kann dafür sorgen, dass bakterielle Hautinfektionen sich ausbreiten. Eine bakterielle Hautinfektion tritt dann auf, wenn Bakterien es schaffen, in die Haut einzudringen. Dafür stehen verschiedene Eintrittspforten zur Verfügung. Einige Bakterien schaffen es, direkt über die kleinsten Risse der Haut oder die Haarfollikel einzudringen. Gerade größere Verletzungen sind jedoch eine häufige Pforte. Dazu gehören:
- Tierbisse
- Sonnenbrand oder andere Verbrennungen
- Operationsnarben
- Einstiche
- Kratzer
- Hauterkrankungen, die für eine Störung der Barriere sorgen
Die Ursache für einen starken Bakterienbefall kann unterschiedlich sein. Oft reicht es schon aus, bei der Gartenarbeit die Wunde mit Erde zu verschmutzen oder möglicherweise in verunreinigtem Wasser zu baden, wie im See oder im Meer.
Bei den bakteriellen Hautinfektionen wird unterschieden zwischen den weniger schwerwiegenden und den schwerwiegenden Ausführungen. Eine eher kleine Infektion tritt bei den folgenden Erkrankungen auf:
- Furunkel
- Karbunkel
- Impetigo
- Ekthym
- Erythrasma
- kleine Abszesse der Haut
Zu den schweren bakteriellen Infektionen der Haut, die auch in das Weichgewebe eintreten, gehören:
- Phlegmone
- Große Abszesse der Haut
- Erysipel
- Wundinfektionen
- Nekrotisierende Hautinfektionen
- Lymphangitis
Infektionen der Haut können durch unterschiedliche Bakterien hervorgerufen werden. Einer der ersten Schritte bei einer Diagnostik ist es daher immer, das Bakterium zu identifizieren, um hier effektiv mit einer Therapie arbeiten zu können.
Die Bakterien, die besonders häufig der Auslöser sind, sind Streptokokken sowie Staphylokokken. Eine hohe Gefahr bringt der bekannte MSRA-Keim mit. Hierbei handelt es sich um den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus. Er wird auch gerne als Krankenhauskeim bezeichnet. Der MSRA hat eine Resistenz gegenüber den meisten Antibiotika entwickelt. Es ist daher besonders wichtig, dass eine Infektion mit MSRA schnell entdeckt wird, um die Behandlung darauf abstimmen zu können.
Risikofaktoren sind vielseitig
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Barriere der Haut gestört ist. Eine mögliche Ursache dafür ist beispielsweise eine Erkrankung mit Diabetes. Nicht nur die Phlegmone hat ein leichtes Spiel, denn Diabetes sorgt dafür, dass die Infektionsabwehr der Haut deutlich vermindert ist. Gleichzeitig ist die Gefahr größer, dass Wunden auf der Haut entstehen. Ältere Menschen haben ein höheres Risiko, an einer bakteriellen Hauterkrankung zu erkranken. Ein zusätzliches Risiko entsteht dann, wenn die Personen im Pflegeheim wohnen oder ins Krankenhaus müssen.
Menschen, die Hepatitis haben oder an einer Immunschwäche leiden, gehören ebenfalls zu den Risikogruppen für die verschiedenen bakteriellen Hautinfektionen.
Generell ist eine beschädigte Haut bei allen Menschen eine Gefahr für das Eindringen von Bakterien. Neben einer guten Wundbehandlung ist es in dem Zusammenhang wichtig, auf eine erhöhte Hygiene zu achten. Kommt es zu frischen Wunden auf der Haut, wie bei Schnitten oder Schürfwunden, sollten diese direkt gereinigt werden. Ebenfalls wichtig ist es, die Wunde mit einem sterilen Verband abzudecken. Dadurch lässt sich die Gefahr mindern, dass Bakterien in den Körper eintreten und eine Infektion auslösen.
FAQ: Phlegmone
Ist Phlegmone ansteckend?
Die Ursache für eine Phlegmone ist normalerweise eine Infektion durch Bakterien. Besonders häufig nachgewiesen werden Streptokokken oder auch Staphylokokken. Die Erkrankung entsteht, wenn die Bakterien in die Haut eindringen und hier für eine Entzündung sorgen. Die Übertragung der auslösenden Bakterien ist möglich. Dringen diese in das Gewebe ein, können sie auch bei einer anderen Person für eine Phlegmone sorgen. Es wird aber nicht von einer Ansteckung gesprochen.
Muss ich mit einer Phlegmone zum Arzt?
Zeigt sich eine Phlegmone auf der Haut, ist eine Kontrolle durch den Arzt immer zu empfehlen. Hierbei kann die erste Untersuchung beim Hausarzt erfolgen. Dieser kann einschätzen, ob eine Behandlung durch einen Facharzt notwendig ist oder der Patient ins Krankenhaus muss.
Ist eine Phlegmone gefährlich?
Eine Phlegmone dringt oft tief in das Gewebe vor und daher stellt sich die Frage, ob es sich um eine gefährliche Erkrankung handelt, die möglicherweise schwere Komplikationen nach sich ziehen kann. Gefährlich wird eine Phlegmone beispielsweise dann, wenn sich ein Abszess bildet, der sich mit Eiter füllt. Unbehandelt kann ein Abszess eine Infektion im Körper auslösen und bis hin zu einer Blutvergiftung führen. Daher sollte Phlegmone immer behandelt werden.
Wie erfolgt die Diagnose?
Um Phlegmone zu diagnostizieren, reicht es normalerweise aus, sich das Erscheinungsbild der Haut anzusehen. Sollte Unsicherheit darüber bestehen, welche Bakterien der Auslöser sind, kann ein Abstrich sinnvoll sein.
- Abszess
Der Abszess entsteht in den tiefen Hautschichten. Es handelt sich um einen Hohlraum, der sich mit Eiter füllt. Eine Besonderheit ist, dass sich der Abszess klar abgrenzt und abkapselt. Es ist möglich, dass sich im Rahmen einer Phlegmone auch ein Abszess entwickelt. Teilweise schmerzt ein Abszess bei Druck oder Berührung. - Wundrose (Erysipel)
Die Wundrose findet sich ebenfalls an Wunden oder Verletzungen. Die Haut nimmt eine hellrote Färbung an, spannt und glänzt. Eine Wundrose ist allerdings sehr scharf begrenzt, auch wenn sie sich nach und nach ausbreitet. Abhängig von der Ausprägung geht sie einher mit Fieber. Sie verbleibt auf den äußeren Hautschichten. - Nekrotisierende Fasziitis
Die nekrotisierende Fasziitis tritt meist an den Armen oder den Beinen auf und ist eine bakterielle Infektion, die schnell lebensbedrohlich werden kann. Sowohl die Faszien als auch die Unterhaut und die Haut entzünden sich. Meist greift die Fasziitis zudem auf die Muskulatur über. Auch bei dieser Erkrankung ist der Auslöser eine Infektion mit Streptokokken. Die Bakterien geben Toxine an die Umgebung ab. Die Toxine lösen die Entstehung von Blutgerinnseln aus. Die Gerinnsel selbst sind sehr klein. Allerdings verhindern sie die Zufuhr von Sauerstoff zu den Zellen. Diese sterben an, sie nekrotisieren (Entstehung von Nekrosen). Diese Erkrankung geht mit sehr starken Schmerzen und oft auch hohem Fieber einher.
Wie sieht es mit der Kostenübernahme bei einer Phlegmone aus?
Bei der Phlegmone handelt es sich um eine Erkrankung, deren Diagnostik und Therapie vollständig von der Krankenkasse übernommen wird. Dies gilt für die medizinisch anerkannten Behandlungen, die der Arzt verschreibt und durchführt. In einigen Fällen kann es zu einem Selbstbehalt kommen. Dies ist abhängig von der Krankenversicherung, die der Patient hat.
Überblick zu den bakteriellen Hautinfektionen
Die Haut ist ein natürlicher Schutz des Körpers und verfügt über eine sehr gute Barriere, sodass Bakterien es schwer haben, wenn sie in den Körper eintreten möchten. Eine gestörte Barriere jedoch kann dafür sorgen, dass bakterielle Hautinfektionen sich ausbreiten. Eine bakterielle Hautinfektion tritt dann auf, wenn Bakterien es schaffen, in die Haut einzudringen. Dafür stehen verschiedene Eintrittspforten zur Verfügung. Einige Bakterien schaffen es, direkt über die kleinsten Risse der Haut oder die Haarfollikel einzudringen. Gerade größere Verletzungen sind jedoch eine häufige Pforte. Dazu gehören:
- Tierbisse
- Sonnenbrand oder andere Verbrennungen
- Operationsnarben
- Einstiche
- Kratzer
- Hauterkrankungen, die für eine Störung der Barriere sorgen
Die Ursache für einen starken Bakterienbefall kann unterschiedlich sein. Oft reicht es schon aus, bei der Gartenarbeit die Wunde mit Erde zu verschmutzen oder möglicherweise in verunreinigtem Wasser zu baden, wie im See oder im Meer.
Bei den bakteriellen Hautinfektionen wird unterschieden zwischen den weniger schwerwiegenden und den schwerwiegenden Ausführungen. Eine eher kleine Infektion tritt bei den folgenden Erkrankungen auf:
- Furunkel
- Karbunkel
- Impetigo
- Ekthym
- Erythrasma
- kleine Abszesse der Haut
Zu den schweren bakteriellen Infektionen der Haut, die auch in das Weichgewebe eintreten, gehören:
- Phlegmone
- Große Abszesse der Haut
- Erysipel
- Wundinfektionen
- Nekrotisierende Hautinfektionen
- Lymphangitis
Infektionen der Haut können durch unterschiedliche Bakterien hervorgerufen werden. Einer der ersten Schritte bei einer Diagnostik ist es daher immer, das Bakterium zu identifizieren, um hier effektiv mit einer Therapie arbeiten zu können.
Die Bakterien, die besonders häufig der Auslöser sind, sind Streptokokken sowie Staphylokokken. Eine hohe Gefahr bringt der bekannte MSRA-Keim mit. Hierbei handelt es sich um den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus. Er wird auch gerne als Krankenhauskeim bezeichnet. Der MSRA hat eine Resistenz gegenüber den meisten Antibiotika entwickelt. Es ist daher besonders wichtig, dass eine Infektion mit MSRA schnell entdeckt wird, um die Behandlung darauf abstimmen zu können.
Risikofaktoren sind vielseitig
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Barriere der Haut gestört ist. Eine mögliche Ursache dafür ist beispielsweise eine Erkrankung mit Diabetes. Nicht nur die Phlegmone hat ein leichtes Spiel, denn Diabetes sorgt dafür, dass die Infektionsabwehr der Haut deutlich vermindert ist. Gleichzeitig ist die Gefahr größer, dass Wunden auf der Haut entstehen. Ältere Menschen haben ein höheres Risiko, an einer bakteriellen Hauterkrankung zu erkranken. Ein zusätzliches Risiko entsteht dann, wenn die Personen im Pflegeheim wohnen oder ins Krankenhaus müssen.
Menschen, die Hepatitis haben oder an einer Immunschwäche leiden, gehören ebenfalls zu den Risikogruppen für die verschiedenen bakteriellen Hautinfektionen.
Generell ist eine beschädigte Haut bei allen Menschen eine Gefahr für das Eindringen von Bakterien. Neben einer guten Wundbehandlung ist es in dem Zusammenhang wichtig, auf eine erhöhte Hygiene zu achten. Kommt es zu frischen Wunden auf der Haut, wie bei Schnitten oder Schürfwunden, sollten diese direkt gereinigt werden. Ebenfalls wichtig ist es, die Wunde mit einem sterilen Verband abzudecken. Dadurch lässt sich die Gefahr mindern, dass Bakterien in den Körper eintreten und eine Infektion auslösen.
FAQ: Phlegmone
Ist Phlegmone ansteckend?
Die Ursache für eine Phlegmone ist normalerweise eine Infektion durch Bakterien. Besonders häufig nachgewiesen werden Streptokokken oder auch Staphylokokken. Die Erkrankung entsteht, wenn die Bakterien in die Haut eindringen und hier für eine Entzündung sorgen. Die Übertragung der auslösenden Bakterien ist möglich. Dringen diese in das Gewebe ein, können sie auch bei einer anderen Person für eine Phlegmone sorgen. Es wird aber nicht von einer Ansteckung gesprochen.
Muss ich mit einer Phlegmone zum Arzt?
Zeigt sich eine Phlegmone auf der Haut, ist eine Kontrolle durch den Arzt immer zu empfehlen. Hierbei kann die erste Untersuchung beim Hausarzt erfolgen. Dieser kann einschätzen, ob eine Behandlung durch einen Facharzt notwendig ist oder der Patient ins Krankenhaus muss.
Ist eine Phlegmone gefährlich?
Eine Phlegmone dringt oft tief in das Gewebe vor und daher stellt sich die Frage, ob es sich um eine gefährliche Erkrankung handelt, die möglicherweise schwere Komplikationen nach sich ziehen kann. Gefährlich wird eine Phlegmone beispielsweise dann, wenn sich ein Abszess bildet, der sich mit Eiter füllt. Unbehandelt kann ein Abszess eine Infektion im Körper auslösen und bis hin zu einer Blutvergiftung führen. Daher sollte Phlegmone immer behandelt werden.
Wie erfolgt die Diagnose?
Um Phlegmone zu diagnostizieren, reicht es normalerweise aus, sich das Erscheinungsbild der Haut anzusehen. Sollte Unsicherheit darüber bestehen, welche Bakterien der Auslöser sind, kann ein Abstrich sinnvoll sein.